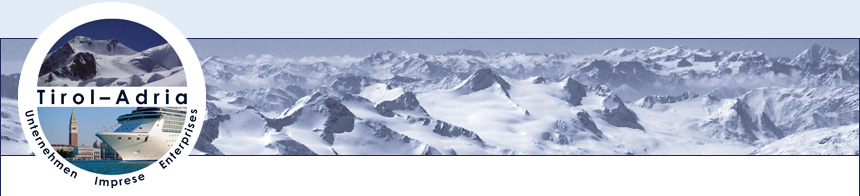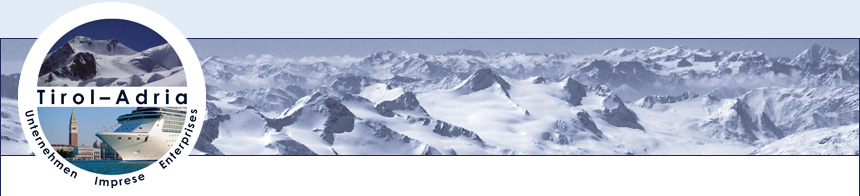|
Projekt
C :
|
 |
|
Flussraumbewirtschaftung „River-Room-Recreation“
- erneuerbare Energie – E-Mobilität
Überdachung von Flüssen, Autobahnen und
Straßen mit PV-Folie um damit elektrischen
Strom zu erzeugen und direkt für die Elektromobilität
auf elektrifizierten Fahrbahnen auf Autobahnen
und Straßen und sogar auf der Wasserstraße
zur Stromversorgung der Schiffe zu verwenden.
Die Kanaltunnels zwischen Inn und Etsch
und die Überdachung auf der gesamten Strecke
der Wasserstraße und der Autobahnen bieten
die Möglichkeit zur Unterbringung der Fahrspuren
für eine Leicht-Hängebahn.
1. Flussraumbewirtschaftung "River-Room-Recreation"
1.1 Hochwasserregulierung
1.2 Ausbau von Flussabschnitten
zu Wasserstraßen (Download
PDF)
1.3
Aquakulturen
1.4 Erschließung
von Lebens-, Erholungs- und Freizeitraum
am Wasser
1.5 Wiedergewinnung
freiwerdender Flächen im aufgelassenen Flussareal
2. Erneuerbare Energie
2.1 Photovoltaik
(Download
PDF)
2.2
Windturbinen
2.3 Wasserkraftwerke
(Download
PDF)
2.4 Strom für
Elektromobilität
3. E-Mobilität
3.1 Einschienen-Hängebahn–System - EHB
3.2 Verkehrsleit- und Stromregulierungssystem
4. Synergien / Kosten
4.1. Stromleitungen verlaufen über der Autobahn - ausreichender Abstand zu Wohnsiedlungen
4.2. Stromleitungen als Tragseile oder zum Tragen der PV-Folienabdeckung
4.3. Die Automatisierung (Elektronische Steuerung - EST -)
4.4. Entlastung der Straßen erhöht die Lebensqualität
4.5. Nutzung örtlicher Energievorkommen
4.6. Kurze Bauzeit
4.7. Baukosten
4.8. Donau-Tirol-Adria-Schiffspassage und die Einschienen Hängebahn
4.9. Die Erdbeben in Italien
4.10. Den Wirtschaftsstandort Europa wesentlich aufwerten
5. Ausblicke
5.1. Kongo-Mittelmeer-Kanal
5.2. Sib-Aral-Kasp-Kanal - Erderwärmung
5.3. Kontinente Afrika und Eurasien verbinden
5.4. Machbarkeit
5.5. Appell
ALLGEMEINES
Die zu erwartenden Folgen des
Klimawandels, die wirtschaftliche und finanzielle
Krise und die Situation auf dem Arbeitsmarkt
gebieten es, das Tirol-Adria-Projekt in
den Bereichen Hochwasserschutz, erneuerbare
Energie, Umwelt, Verkehr weiterzuentwickeln
und auf andere Gebiete auszudehnen.
FLÜSSE IN NORDOST-ITALIEN
Die Etsch, der längste Fluss in Nordost-Italien,–
führt in seinem flachen Teil sehr nahe an
den Alpenhauptkamm heran, und ist daher
geeignet, einen Wasserweg zwischen
Adria und Donau zu realisieren.
Im Tirol-Adria-Projekt –
Teile A und B - wird die Verbindung der
europäischen Binnenwasserstraßen mit dem
Adriatischen Meer dargestellt. Zur Schiffbarmachung
von Flüssen, ist die Hoch- und Niedrigwasserregulierung
eine wichtige Voraussetzung.
Die Flüsse Isonzo, Torre, Natisone, Tagliamento,
Degano, But, Fella, Meduna, Cellina, Livenza,
Piave und Brenta führen in der Regel während
der Schneeschmelze oder der Regenfälle im
Herbst Hochwasser, und haben deshalb auch
sehr breite Flussbette (teilweise sind diese
sogar einige Kilometer breit). In Trockenperioden
hingegen, haben diese Flüsse – auch
wegen der Ausleitungen für Kraftwerke und
Bewässerungen - nur mehr eine geringe Wasserführung
und sind streckenweise aufgrund von Versickerungsverlusten
sogar trocken. Ufergemeinden und vor allem
die teilweise sehr dicht besiedelten Gebiete
in der Ebene leiden unter dieser ständigen
Hochwassergefahr. Projekte zur Bannung dieser
Gefahr sind daher vorrangig.
Die außerordentlich breiten Flussareale
erfordern eine umfassende Flussraumgestaltung.
Dabei können frei werdende Flächen neuen
Nutzungen zugeführt werden. Die Nutzung
der Wasserkraft und der Sonnenenergie zur
Stromproduktion ist bei der Neugestaltung
des Flussraumes ein auszuschöpfendes Potential.
1. FLUSSRAUM-BEWIRTSCHAFTUNGSKONZEPT – "RIVER-ROOM-RECREATION"
1.1 HOCHWASSERREGULIERUNG
1.1.1 Der schnelle
Wasserabfluss bei Hochwasser bedroht
die Ortschaften am Unterlauf und behindert
die Schifffahrt. An einigen Oberläufen,
z.B. am Cellina-Fluss, wurden Stauseen errichtet,
die Wasser zurückhalten können. In den Flussläufen
soll das Wasser durch bis zu 6 m hohe Schlauchwehre
zu einer Kette von Speicherseen aufgestaut
und seitlich durch Dämme begrenzt werden.
Die Breite des neuen Flussbettes richtet
sich nach dem jeweiligen Flussquerschnitt
am Unterlauf.
1.1.2
Das jeweils oberste Staubecken soll als
Rückhalte- und Auffangbecken
ausgelegt werden, um größere Wassermengen,
aber auch Sand, Schotter und Treibgut zurückzuhalten,
und so dem Wasser seine zerstörerische Kraft
zu nehmen. Auch das jeweils unterste
Becken wird für eine größere Wassermenge
ausgelegt, damit bei einem Stromüberangebot
die an den jeweiligen Stauwehren eingebauten
Turbinen/Generator-Einheiten angehalten
oder im Rückwärtslauf als Pumpen fungieren
und das Wasser in das jeweils obere Becken
zurückbefördern können.
1.1.3
An geeigneten Orten werden Flächen für die
Hochwasserregulierung als
sogenannte Polder genutzt. Um dieses System
des Hochwasserschutzes zu ermöglichen, werden
diese Flächen terrassenförmig angelegt.
Durch die teilweise Erhöhung des Wasserspiegels
kann bei Hochwassergefahr eine kontrollierbare
Wassermenge an dazu vorgesehenen Stellen
zum Überlaufen in die Polder gebracht werden.
1.2 AUSBAU
VON FLUSSABSCHNITTEN UND WASSERSTRASSEN
1.2.1 Durch den Einbau
von Schiffsschleusen an
den Stauwehren können Flüsse als Wasserstraße
auch mit elektrisch betriebenen Schiffen
bis zu bedeutenden Wirtschaftsstandorten
in den Flusstälern befahren werden: z. B.
Meran an der Etsch, Görz am Isonzo, Ponte
al Tagliamento, Nervese della Battaglia
am Piave, Bassano del Grappa am Brenta.
1.2.2 Schiffsschleusen:
Die 112 m oder 224 m lange und 12 m breite
Schiffsschleuse wird direkt im Flussbett
mit eingerammten und abgedichteten Spundwänden
errichtet. Diese werden zur jeweiligen Bachböschungskrone
hin waagrecht abgestützt. Durch die wasserdichte
Ummantelung der Stütz- und Absicherungsstruktur
entsteht ein Luftkissen, das mit Bodenplatten
abgedeckt zu einer begeh- und befahrbaren
auf dem Oberwasser schwimmenden Fläche wird.
Bei jeder Schleuse ist ein Übergang auf
die gegenüberliegende Seite möglich, sodass
der Fluss überquert werden kann. Die Schließorgane
der Schleuse werden bei Hochwasser geöffnet,
damit dieses ungehindert auch durch die
Schleuse abfließen kann, die somit kein
Hindernis oder Einengung des Flussquerschnittes
darstellt.
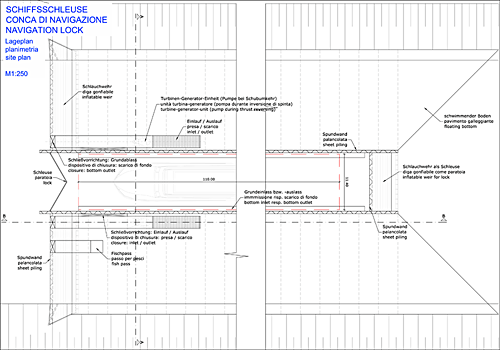
1.2.3 Die Anhebung/Absenkung
des Wasserspiegels in der Schleuse
erfolgt mittels Pumpturbinen,
welche Wasser aus der Oberwasserstauhaltung
durch seitlich einmündende Kanäle ab- oder
einpumpen.

1.2.4 Wasserstraße Padova-Mare:
In diesem Kontext soll die noch nicht vollendete
Wasserstraße Padova-Mare in die Binnenwasserstraße
Brenta-Fluß einbezogen, mit PV-Überdachung
zur Stromgewinnung und mit elektrischen
Oberleitungen versehen und für den Schiffsverkehr
freigegeben werden.
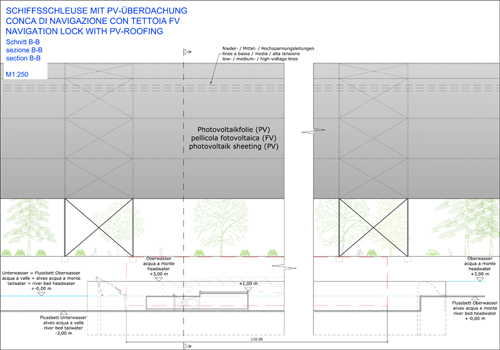
1.3 AQUAKULTUREN
1.3.1 In den jeweiligen
Stauräumen wird das Wasservolumen –
bezogen auf den heutigen Stand – besonders
in den Restwasserstrecken
um ein Vielfaches erhöht. Dies schafft bei
der vorhandenen Wasserqualität gute Voraussetzungen
für Aquakulturen, besonders
für die Fischzucht. Da
in den einzelnen Staubereichen verschiedene
Arten oder Größen gehalten werden, ist eine
Fischwanderung unerwünscht und daher ein
Fischpass nicht erforderlich. Bei Bedarf
kann das System einen praktikablen Übergang
gewährleisten.
1.3.2
Dieser neue Wirtschaftszweig
(Fischzucht in Flussökosystemen) hat in
einer Zeit der überfischten Meere weltweit
eine große Zukunft zu erwarten und wird
von der EU und der Republik Italien gefördert.
Mit Gesetz vom 05.03.2001, Nr. 57, soll
die Entwicklung des ländlichen Raumes gefördert
und die Erwerbstätigkeit in den Bereichen
Landwirtschaft und Fischzucht (Aquakultur)
sowie Umwelt- und Landschaftsschutz gesteigert
werden.
1.4 ERSCHLIESSUNG
VON LEBENS-, ERHOLUNGS- UND FREIZEITRAUM
WASSER
1.4.1 Im Flussraum
entstehen größere Wasserflächen, welche
das Landschaftsbild verschönern und aufgrund
der größeren Verdunstungsfläche auch für
ein angenehmes Klima sorgen. In den Städten
sowie den anderen flussnahen Ortschaften
erhält der Fluss ein neues Aussehen: War
vorher das Flussbett aufgrund der Ausleitungen
fast leer oder wegen der Spitzenstromproduktion
zeit- und streckenweise fast leer bzw. voll
tosender Wassermassen, so wird der Fluss
nun eine Atmosphäre der Ruhe ausstrahlen.
1.4.2 Diese neu gewonnene
Lage als Stadt oder Ort am Wasser wird dazu
führen, dass an geeigneten Plätzen aquatische
Anlagen für den Wassersport, Angleroasen
am Flussufer sowie Naherholungsbereiche
entstehen. Bei Schlauchwehren können Übergänge
(Rutschen) für Boote eingerichtet werden.
1.4.3 Mit den Aquakulturen
und der Gewinnung des Flussgebietes als
Lebens-, Erholungs- und Freizeitraum
am Wasser, werden den Bewohnern
neue Lebens-, Beschäftigungs- und Wirtschaftsperspektiven
eröffnet.
1.5 WIEDERGEWINNUNG
FREIWERDENDER FLÄCHEN IM AUFGELASSENEN FLUSSAREAL
Die freiwerdenden Flächen alter Flussareale
- außerhalb des neu angelegten Flussbettes
- werden neuen Nutzungen zugeführt.
Diese können sein:
1.5.1
Verkehrswege
Auf dem
seitlichen Damm sind Fahrbahnen für den
Autoverkehr, Fahrrad- und Wanderwege vorgesehen.
Diese werden an die bestehenden Verkehrswege
der Ufergemeinden angebunden. Eine Fahrbahn
je Fahrtrichtung kann für die Elektromobilität
adaptiert werden.
1.5.2 Landwirtschaftliche
Kulturgründe
Über 10.000 ha
aufgelassener Flussareale werden der landwirtschaftlichen
Nutzung, z.B. für den Reisanbau, zugeführt
und könnten je nach Art des Anbaues (Tomaten)
ebenfalls überdacht und zur PV-Stromerzeugung
verwendet werden. Zur Bewässerung dieser
Flächen sollen Anlagen mit effizienten aber
gleichzeitig wassersparenden Systemen gebaut
werden.
1.5.3
Freizeit- und Erholungsparks, Sportanlagen,
touristische Einrichtungen
1.5.4 Schutzgebiete
für Tiere
1.5.5
Blühende Landschaften
Auf diese Weise können die sogar aus dem
All sichtbaren Gesteins- und Sandwüsten
in den genannten Flusstälern Nordostitaliens
in „blühende Landschaften“ verwandelt
werden, um einen Ausspruch des Kanzlers
Kohl nach dem Fall der Berliner Mauer zu
gebrauchen.
Wüstenlandschaften an
Flussläufen sind in einer Zeit der Kulturgrundverknappung
ein Nonsens.
Dieses Flussraumbewirtschaftungskonzept
kann man unter der Bezeichnung „River-Room-Recreation"
treffend zusammenfassen und mit RRR abkürzen.
1.5.6 Die Neugestaltung
und Kultivierung der Flussareale
beinhaltet auch die Nutzung der erneuerbaren
Energiequellen.
2. STROM AUS ERNEUERBARER ENERGIE
2.1 Photovoltaik –
PV
2.1.1 PV-Überdachung von Flüssen
und Kanälen in der Form eines Baldachins
Flüsse und Schiffskanäle sollen mit einer
Solarfolie überspannt werden, die auf einer
satteldachförmigen Fachwerkkonstruktion
aus Stahl angebracht wird. Die Stützen des
Traggerüstes werden an beiden Ufern und
bei breiteren Flüssen auch im Flussbett
eingerammt. Das Foliendach soll eine Neigung
von 45 Grad haben und seitlich in einer
Höhe von 5 m enden, damit der Schnee sicher
abrutscht und in den Fluss fällt und die
Sicht auf das Wasser frei bleibt.
Flüsse stellen einen ununterbrochenen
Raum (Korridor) dar und sind daher für Leitungstrassen
besonders geeignet.
.
Im Traggerüst
unterhalb der Folienabdeckung können
- Hochspannungsleitungen in verschiedenen
Spannungsebenen,
- Versorgungs- und
Oberleitung für die elektrisch betriebenen
Binnenschiffe sowie
- Fahrspuren für
Hängebahnen verlaufen. (Schwebebahn Wuppertal)
- Wasserstraße Donau-Tirol-Adria –
Projekt B
Bei einer Folienüberdachung der Wasserstraße
auf den Flüssen Inn und Etsch zwischen Passau
an der Donau und Venedig mit einer Länge
- unter freiem Himmel - von 620 km ergibt
dies eine Folienfläche von (620.000 m Länge
und 100 m Breite) 62.000.000 m².
Bei
100 kWh/m² ergibt dies die Jahresproduktion
eines Atomkraftwerkes von 6.200.000.000
kWh oder
- eine Jahresproduktion von 10.000.000
kWh pro km Wasserstraße.
2.1.2 PV-Überdachung
von Straßen und Autobahnen
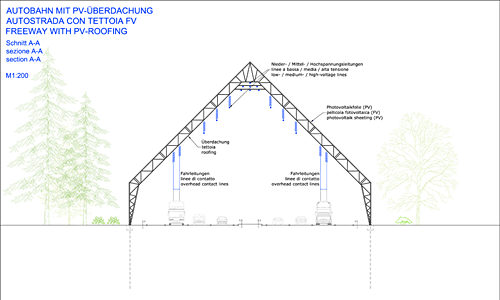
In gleicher Weise wie Flüsse und Wasserstraßen
sollen auch Straßen und Autobahnen zur Gewinnung
von Sonnenenergie mit PV-Folie überdacht
werden.
- Pro Straßenkilometer können so jährlich
1.200.000 kWh und
- pro Autobahnkilometer 4.400.000
kWh elektrischer Strom gewonnen werden.
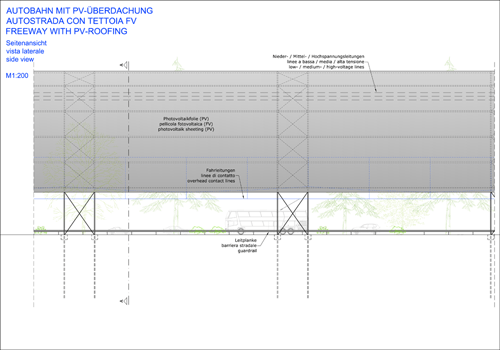
2.1.2.1 Stromleitungen
Unter dieser Überdachung können wiederum
Hoch-, Mittel- oder Niederspannungsleitungen
sowie je eine Oberleitung für Elektrofahrzeuge
pro Fahrtrichtung verlaufen.
2.1.2.2 Positive Nebeneffekte
der PV-Überdachung oder des PV-Baldachins:
- Kein Schnee auf der Fahrbahn
- keine Eis- und Reifbildung,
- keine Schneeräumung, kein Einsatz
von Salz und Splitt.
- längere Lebensdauer der Asphaltdecke,
- mögliche Lärmminderung.
- Freie Sicht nach den Fahrbahnseiten
2.1.3 PV-Überdachung von Sportstadien,
landwirtschaftlichen Intensivkulturen oder
überall dort, wo eine Überdachung von mehrfachem
Nutzen ist;
2.1.4 Schwimmende
PV-Elemente auf Wasserflächen wie
z.B. offene Speicherbecken.
2.2 Windturbinen
Zur Nutzung des Aufwindes, welcher durch
die Erwärmung der Luft unter der Überdachung
entsteht, werden horizontale Windturbinen
im Giebel der Überdachungen eingebaut. Aus
Mangel an Erfahrungswerten ist ihre Leistung
jedoch noch nicht vorhersehbar.
2.3 Wasserkraftwerke
an den Staustufen
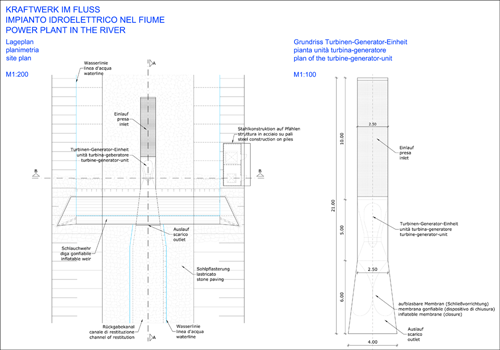
2.3.1 An den jeweiligen
Staustufen werden direkt
im Flussbett Unterwasser-Turbinen-Generator-Einheiten
eingebaut, die mit dem vorhandenen Wasserdargebot
und bei dem jeweiligen Gefälle elektrischen
Strom erzeugen. Im Rückwärtslauf (Schubumkehr)
können die Einheiten Wasser in das jeweils
darüber liegende Becken pumpen und dadurch
- bei einem eventuellen Überangebot - Strom
vom Netz zu nehmen und als erneuerbare Energie
zu speichern.
2.3.2
Um Produktions- und Verbrauchskapazitäten
auszugleichen, werden auch Hochdruck-Pumpspeicherkraftwerke
errichtet, die vor allem Produktionsspitzen
abfangen und den Stromtransport durch das
Hochspannungsleitungsnetz optimieren.
2.4 Strom
für Elektromobilität
Die Stromerzeugungs- und Übertragungsanlagen
liegen entlang dieser Hauptverkehrswege
(Wasserstraße, Eisenbahn, Autobahn, Staats-
und Landesstraßen, Fahrradwege) und sind
daher geeignet:
2.4.1
das Stromnetz
der elektrifizierten Fahrspuren
der Autobahnen, Straßen und Wasserstraßen
zu speisen,
2.4.2
leistungsstarke Schnellladestationen
für elektrisch betriebene Fahrzeuge bei
Raststätten und Parkplätzen (Park &
Charge) direkt zu betreiben.
2.4.3 Außerdem könnte der
Strom in das Leitungsnetz der Eisenbahn
eingespeist werden, da die Kraftwerke in
ihrer unmittelbaren Nähe errichtet werden.
3. ELEKTROMOBILITÄT
Durch den AlpenKanalTunnel verlaufen zwei Verkehrsadern, und zwar die
- Wasserstraße Donau-Tirol-Adria und im Tunnelgewölbe die
- Einschienen Hängebahn – EHB – München-Innsbruck-Verona, sowie
- Strom- und Datenleitungen.
Dies führt zur Erkenntnis, dass Verkehrswege und Wasserläufe als durchgehende Korridore für eine intensivere und mehrfache Nutzung geeignet sind und daher genutzt werden sollen.
3.1 Einschienen-Hängebahn–System - EHB
Photovoltaiküberdachung von Autobahnen und Straßen sowie Wasserstraßen
- zur Stromerzeugung
- zur Aufhängung der Multifunktionsschiene als Fahr-, Strom- und Leitschiene und
- zur Unterbringung von Strom- und Datenleitungen, die wiederum als Tragelemente der PV-Überdachung und der Multifunktionsschiene fungieren.
3.1.1 Zumindest eine Fahrspur je Fahrtrichtung wird mit einer Oberleitung für Elektrofahrzeuge ausgestattet. Als Oberleitung wird eine Multifunktionsschiene mit integrierter Gleich- oder Wechselstromleitung und Leitspur in 5 m Höhe aufgehängt.
3.1.2. Daran rollen oberhalb der 1. Fahrspur Trolleys mit Hebewerk (Lift)
3.1.2.1. zur schwebenden Beförderung von Personen und Gütern in Kabinen, Containern
(<10 t) und anderen Arten,
3.1.2.2. zum Ziehen und Steuern von Fahrzeugen ohne eigenen Antrieb (Anhänger) für Lasten, die nicht hängend befördert werden können oder für Diesel-LKW während einer Übergangszeit,
3.1.2.3. zur Übertragung von Strom und Steuerungsdaten an e-Fahrzeuge.
Batteriebetriebene Fahrzeuge können während der Fahrt laden,
3.1.2.4. zum Betrieb einer Hochgeschwindigkeits-Einschienen-Hängebahn – HGHB – Aerobus - oberhalb der (letzten) Überholspur.
Bei einer 2-spurigen Straße verläuft die Schiene der eventuellen Hochgeschwindigkeits-EHB in der oberen Etage in ca. 7,5 m Höhe unterhalb der PV-Überdachung .
3.1.3 Das Einschienen-Hängebahn-System ermöglicht geradezu bahnbrechende Anwendungen. Ist es doch die Straße selbst, die dadurch den Personen- und Güterverkehr auf oder an die Schiene bringt und elektrifiziert! Dies wird durch die besondere Art der Multifunktionsschiene anstelle der elektrischen Oberleitung und die sehr flachen Fahrwerke (Trolleys mit Hebewerk) ermöglicht.
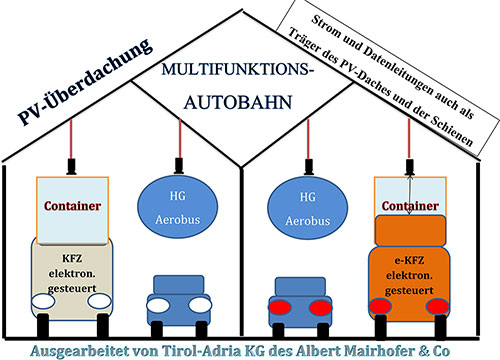

3.1.4. Diese Aerobuskabinen werden in diesem Fall sehr flach bis zu 2 m Höhe und bis 3 m Breite gestaltet, sodass auf der darunterliegenden Spur das Fahren mit Kfz bis 2,5 m Höhe uneingeschränkt möglich ist.
3.1.5. Die aerodynamische Form der Hängebahn bewirkt zudem, dass der Druck auf die Fahrwerke und die Fahrschiene mit zunehmender Geschwindigkeit abnimmt und der Passagier das Gefühl des Fliegens hat.
3.1.6. Für hohe Schwerfahrzeuge ist die Benutzung der Überholspur ohnehin nicht sinnvoll und daher erfährt der jeweilige Verkehrsweg besonders auch durch die elektronische Steuerung - EST - eine Verbesserung bezüglich Fahrsicherheit, Umwelteinflüsse und Leistung.
3.1.7. Die erste Fahrspur teilen sich Hängebahn und Straßenfahrzeuge, wobei Kraftfahrzeuge bis zu 2 m Höhe und die Hängebahn sich gegenseitig nicht einschränken.
3.1.8. Durch die Elektrifizierung wird die Umweltbelastung durch Abgase eliminiert und die Lärmbelästigung reduziert.
3.1.9. Der Antrieb der Fahrzeuge soll in Zukunft wegen der vielen Vorteile (Wirkungsgrad) rein elektrisch erfolgen. Schwere E-Fahrzeuge werden noch mit einem kompakten Stromgenerator ausgerüstet, der die Stromversorgung auf nicht elektrifizierten Strecken sicherstellt.
3.2 Verkehrsleit- und Stromregulierungssystem:
3.2.1 In die Multifunktionsschiene soll zudem ein Leit- und Überwachungssystem integriert werden, das automatisiertes Fahren ermöglicht, das die Fahrsicherheit und die Leistungsfähigkeit der Autobahn wesentlich erhöht.
3.2.2 Jeder elektrisch betriebene Bus oder LKW, der bei elektrifizierten Fahrbahnen den Strom aus der Oberleitung bezieht, ist für Fahrten auf nicht elektrifizierten Strecken mit einem Stromgenerator mit einer Leistung von etwa 200 kWel oder - in Zukunft mit einem stärkeren Stromspeicher ausgestattet. Diese können durch das Stromregulierungssystem innerhalb von Sekunden in Betrieb genommen werden und den Überstrom über dieselbe Oberleitung in das Stromnetz zurückspeisen und so von einem Stromabnehmer zu einem Stromlieferanten werden. 10.000 LKW (zum Vergleich: 6.000 LKW fahren täglich über den Brennerpass) können die Leistung von 2 Atomkraftwerken, also 2.000.000 kW erbringen und damit das Stromversorgungsnetz stützen. So könnte z.B. einer örtlich auftretenden Überlastung des Stromnetzes durch Zuschaltung der Hilfsaggregate oder Stromspeicher der Elektrofahrzeuge im betreffenden Bereich begegnet werden.
3.2.3. Die Elektrifizierung und Automatisierung des Verkehrs ist mit bestehender Technik heute schon möglich.
4. Synergien / Kosten:
4.1. Stromleitungen verlaufen über der Autobahn und haben somit ausreichenden Abstand zu Wohnsiedlungen;
4.2. Stromleitungen fungieren zugleich als Tragseile für die Hängebahnschiene oder, - als isolierte Stromkabel sogar zum Tragen der PV-Folienabdeckung;
4.3. die Automatisierung (Elektronische Steuerung - EST -) der Autobahn- und Hängebahn-strecke erfolgt durch diese neuen Strukturen und ermöglicht zugleich nicht nur sichereres Fah-ren und geringere Betriebskosten, sondern größeren und umweltgerechteren Durchsatz im Personen- und Gütertransport.
4.4. Entlastung der Straßen erhöht die Lebensqualität
4.5. Nutzung örtlicher Energievorkommen: Die Antriebsenergie wird auf der PV-Überdachung und in den Wasserkraftwerken längs der Verkehrsadern regenerativ erzeugt und bereitge-stellt.
4.6. Kurze Bauzeit: Die Errichtung dieser Anlagen ist ohne große Störungen des Umfeldes möglich. Die Bauteile werden vorgefertigt angeliefert und an Ort und Stelle eingebaut und in Betrieb genommen.
4.7. Baukosten: Die Kosten der EHB gegenüber einer traditionellen Eisenbahn können um weit mehr als die Hälfte reduziert werden und wenn die Synergien optimal genutzt werden, können die Kosten gegenüber einer italienischen Hochgeschwindigkeitsbahn auf 1/10 = circa 5-6 Millionen €/km reduziert werden.
4.8. Durch die Donau-Tirol-Adria-Schiffspassage und die Einschienen Hängebahn kann Europa mehrere viele Milliarden Euro teure Projekte einsparen, darunter Hochgeschwindigkeitsstrecken wie den BBT, da man inzwischen auch weiß, dass Mischverkehr nicht möglich sein wird, oder Güterverkehr auf solchen Strecken ein Nonsens ist und daher auch keine Entlastung der Autobahn zu erwarten ist!! Die erforderlichen Zulaufstrecken zum Brenner Basistunnel könnte man sich ebenfalls ersparen.
4.9. Die Erdbeben in Italien werfen auch die Frage der Sicherheit der „TAV“s auf. Sollten Milliarden in Hochgeschwindigkeitszüge investiert werden, wenn das System Hängebahn sicherer – es kann nicht entgleisen – und für ein gebirgiges Land wie Italien geeigneter ist und noch die weiter oben aufgezeigten Vorteile hat.
4.10. Der wichtigste Aspekt des Alpenkanals ist aber, dass finanziell angeschlagene Mittelmeerstaaten näher an Europa rücken und Europa näher an das Mittelmeer und dadurch den Wirtschaftsstandort Europa wesentlich aufwerten und neue Perspektiven eröffnen. Dies wird eine europaweite Verlagerung auf die umweltverträglicheren Binnen- und Küstenschiffe und auf das Einschienen-Hängebahn-System zur Folge haben und zu großen Einsparungen an Zeit und Energie führen.
5. Ausblicke:
Auf der Grundlage des Tirol-Adria-Projektes könnten die Projekte „Transaqua“, „Interafrica“ (Wassertransfer Kongo-Tschad-Libyen) http://www.transaquaproject.it und „Desertec“, die Solarstrombrücke nach Europa zum
5.1. Kongo-Mittelmeer-Kanal
vereint werden. Durch die Überleitung von ca. 3.000 m³/s (ein zweiter Nil) aus dem Ubangi, dem größten rechtsseitigen Kongozufluss, entstünde ein schiffbarer Wasserweg durch die Wüste, der direkt nur 3 Staaten betrifft, und zwar: Zentralafrika, Tschad und Libyen. Der Tschadsee könnte wieder zum ursprünglichen Stand zurückkehren, für den "Great Man-Made River" könnte dadurch die Wasserbereitstellung auch für die Zukunft gesichert und Wüste in fruchtbares Land verwandelt werden.
Die PV-Überdachung des Wasserlaufes vermeidet die Verdunstung und liefert Strom für die Pumpstationen, für den örtlichen Gebrauch und die Einspeisung in die Leitungen, die durch die Überdachung verlegt werden.
- Durch die überdachte Wasserstraße könnten eine schnelle Einschienen-Hängebahn- EHB - (Wuppertaler Schwebebahn)
sowie die Stromschiene für den elektrischen Betrieb von Binnenschiffen verlaufen. Ein großer Schritt in Richtung Elektromobilität !
5.2. Sib-Aral-Kasp-Kanal - Erderwärmung
Dieser Plan (Dawydow-Plan) zur Überleitung der vom Süden nach Norden, durch Sibirien in das Nördliche Eismeer fließenden Wassermenge von ca. 500 km³ im Jahr (500.000.000.000 m³ im Jahr = 16.000 m³ in der Sekunde) der Flüsse Ob/Irtysch und Jenissei in den wüstenhaften Süden, zum austrocknenden Aralsee, hätte große Auswirkungen zur Einschränkung der Klimaerwärmung. Das im Schnitt ca. 10° C wärmere Wasser wird nicht mehr in das -1,6° bis -1,9° C kalte Nördliche Eismeer fließen und dieses aufwärmen, sondern in den wärmeren aber trockenen Süden fließen und dort zur Kultivierung und indirekt zu angenehmerem Klima führen. Ein mehrfacher Effekt!
Dem nördlichen Eismeer würden so etwa 5.000 TWh (Terawattstunden) (5.000.000.000.000 kWh) Wärmeenergie weniger zugeführt, (Basis: 1 kWh erwärmt 1 m³ Wasser um 1°C). was der jährlichen Stromproduktion von 625 Atomkraftwerken (AKW) oder der 1.000-fachen Stromproduktion Südtirols entspricht.
Am Beispiel der Erdölförderung von Saudi Arabien: Die durch die Verbrennung von 70 % des geförderten Erdöls (ca. 1.800.000 m³ täglich = 20.800 Liter – ein volles Tankfahrzeug - pro Sekunde) freigesetzte Wärme würde in etwa dieser Wärmemenge entsprechen!
Eine ganzjährig schiffbare Wasserstraße mit Strom- und Gasleitungen und einer modernen Hochgeschwindigkeits-Hängebahn zum Kaspischen See und zum Mittelmeer wird das rohstoffreiche Sibirien erschließen und den Wirtschaftsräumen um das Mittelmeer näherbringen.
5.3. Im Mittelmeer die Kontinente Afrika und Eurasien verbinden!
Die Stromleitungen und die Einschienen-Hängebahn könnten durch Autobahn- oder Straßenüberdachungen vom Mittelmeerhafen der Kanalmündung im Golf von Syrte in Libyen bis zur Meerenge zwischen Tunesien und Sizilien fortgeführt und dort - aufgeständert auf Pontons - die Meerenge überbrücken und so im Mittelmeer die Kontinente Afrika und Eurasien verbinden, wobei die Schienen der Hängebahn sogar an der Hochspannungsleitung, (Solarstrombrücke Afrika-Europa) hängend den Kanal von Sizilien und die Straße von Messina überspannen, wie es in diesem Video sehr eindrucksvoll dargestellt wird!
Dies würde die verkehrsmäßige Erschließung großer kaum zugänglicher Räume vom Kongo bis zum Mittelmeer und für die schiffbaren Flüsse des Kongobeckens und Sibiriens eine direkte Verbindung zum Mittelmeer, zu Europa bedeuten. Diese Kontinente verbindenden Werke hätten es in sich, besonders afrikanischen Völkern neue Perspektiven zu eröffnen und den Flüchtlingsstrom aufzuhalten!
5.4. Machbarkeit
Um eventuelle Zweifel an der Machbarkeit des Kongo-Mittelmeer-Kanals zu beseitigen, mache ich ein einfaches Beispiel:
Saudi Arabien fördert 11.700.000 Barrel Öl pro Tag, was einer Fördermenge von 1.800.000 m³ täglich entspricht.
Ein Kilometer Kanal mit einer Breite von 100 m und einer Tiefe von 10 m entspricht einem Aushub von 1.000.000 m³ und vergleichend könnte man 1,8 km Kanal täglich, 500 km im Jahr und den gesamten Kanal von 3.000 km Länge in 6 Jahren ausheben! Überdies kann moderne Technik den Kanalbau noch revolutionieren.
5.5. Appell
Ich glaube es wäre an der Zeit, Panzer zu Baggern umzurüsten! Deshalb appelliere ich, diese großen Vorhaben zu einer Angelegenheit der gesamten Menschheit zu machen und umzusetzen, bevor das Wasser des Kongo im größten Kraftwerk der Welt am Abfluss zum Atlantik nur energetisch genutzt wird, wo doch der gesamte Raum nördlich des Kongo nach Wasser lechzt und die Folgen der Erderwärmung sich immer deutlicher zeigen.
PS: Die Pläne des Südtirolers Alois Negrelli für den Suezkanal wurden Jahrzehnte später von Lesseps umgesetzt!
Wir haben jedoch nicht mehr so viel Zeit!
Tirol-Adria
Ideator & Manager: Albert Mairhofer
Stand: Mai 2019
|